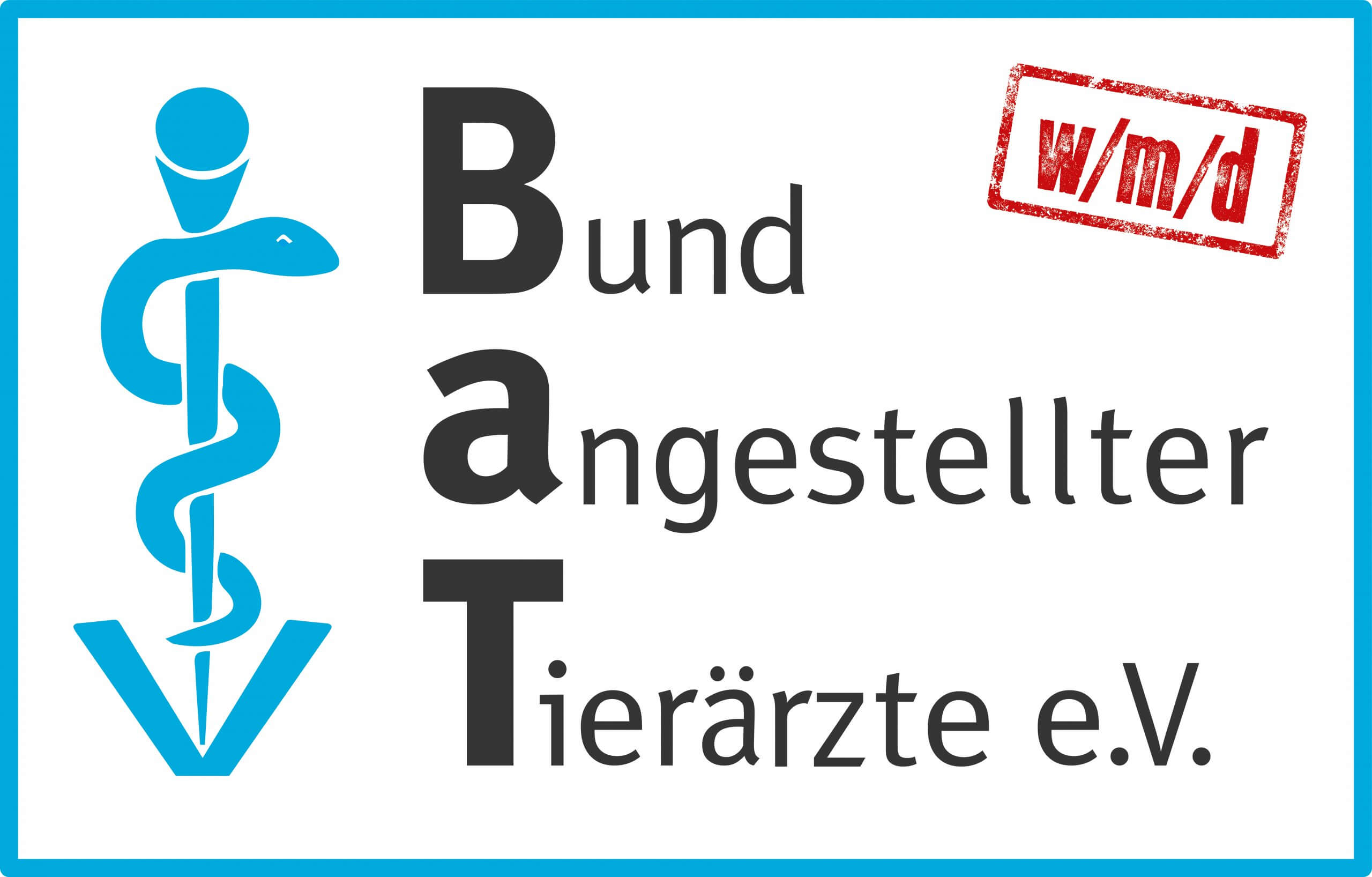Kündigung eines Arbeitsverhältnisses
Welche Kündigungsfristen gelten? Welcher Kündigungsschutz greift bei welchen Personengruppen? Und wie ist die Lage im Beschäftigungsverbot?
Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem das Arbeitsverhältnis endet – sei es durch Zeitablauf (bei befristeten Arbeitsverhältnissen), durch eine (in der Regel ordentliche) Kündigung oder schlichtweg durch das Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze. Mögliche Gründe für die Beendigung gibt es viele.
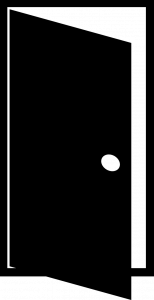
Wann erfolgt eine Kündigung?
Das mit den meisten rechtlichen Fragestellungen belegte Thema dürfte hierbei freilich die Kündigung sein. Eine solche kann sowohl vom Arbeitgeber, als auch vom Arbeitnehmer ausgesprochen werden. Insbesondere im Falle einer arbeitgeberseitigen Kündigung tun sich oftmals Probleme auf – in vielen Fällen ist die Kündigung des Arbeitnehmers an strenge Voraussetzungen geknüpft und unter Umständen schlichtweg nicht möglich. Diesem Kündigungsschutz wollen wir uns im Folgenden vornehmlich widmen.
Aber kommen wir zunächst zu einem weniger komplizierten Part der Kündigung: die sog. Kündigungsfristen.
Kündigungsfristen
Diese sind üblicherweise bei jeder Kündigung einzuhalten – ausgenommen im Falle der außerordentlichen (fristlosen) Kündigung. Diese kann nur dann wirksam ausgesprochen werden, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt, dass die Fortführung unter Einhaltung der einschlägigen Kündigungsfristen einer Vertragspartei nicht zumutbar ist.
Im Falle der in den meisten Fällen ausgesprochenen ordentlichen Kündigung kann das Arbeitsverhältnis nicht von heute auf morgen beendet werden. Vielmehr muss der jeweils anderen Vertragspartei die Möglichkeit gewährt werden, sich auf das Ende des Arbeitsverhältnisses einzustellen und entsprechende Vorbereitungen zu treffen.
Das Gesetz spricht dem Arbeitnehmer hier oft eine längere „Vorbereitungszeit“ zu, als dem Arbeitgeber.
So hat letzterer bei der Kündigung seines Arbeitnehmers, der seit mehr als zwei Jahren für ihn tätig ist, gem. §622 Abs. 2 S. 1 BGB eine Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats zu berücksichtigen.
Die Kündigungsfristen verlängern sich mit steigender Dauer der Betriebszugehörigkeit, bis schließlich ab einer Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren eine Kündigungsfrist von sieben Monaten erreicht wird.
Zum Vergleich: der Arbeitnehmer kann nach den gesetzlichen Vorgaben das Arbeitsverhältnis unabhängig von der Dauer der Betriebszugehörigkeit – also auch nach 20 Jahren — mit einer Frist von vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats kündigen.
Wichtig zu wissen: während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von beiden Seiten mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.
Von oben genannten Kündigungsfristen kann außerdem – in gewissen Grenzen — durch vertragliche Vereinbarungen abgewichen werden.
Kündigungsschutz
Etwas komplizierter, als die Frage nach den einschlägigen Kündigungsfristen, ist die nach dem Kündigungsschutz. Greift dieser, erübrigt sich alles weitere.
In der Regel bekannt sein wird der allgemeine Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz. Dieser stellt sicher, dass eine (ordentliche) Kündigung nicht sozial ungerechtfertigt ist. Dies ist dann der Fall, wenn ein personenbedingter (in der Person des betreffenden Arbeitnehmers liegender), ein verhaltensbedingter (im Verhalten des betreffenden Arbeitnehmers liegender) oder ein betriebsbedingter Kündigungsgrund vorliegt. Dieser muss in der Kündigung vom Arbeitgeber erläutert werden.
Wann greift das Kündigunsschutzgesetz nicht?
Eine Kündigung ohne Angabe von Gründen ist nur dann möglich, wenn das KSchG nicht greift. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen die Grenze von mehr als zehn Arbeitnehmern (Teilzeitangestellte werden nur anteilig berücksichtigt, Auszubildende gar nicht) nicht überschreitet oder aber, wenn sich der Arbeitnehmer noch in der Probezeit befindet. Diese darf übrigens maximal sechs Monate betragen.
Gut zu wissen: In Kleinunternehmen finden die Vorschriften des Kündigungsschutzgesetzes keine Anwendung – der Arbeitgeber kann ohne Angabe von Gründen die Kündigung erklären. Dies bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass der Arbeitnehmer den Launen seines Arbeitgebers per se machtlos ausgeliefert ist. Die Kündigung darf insbesondere nicht gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstoßen.
Hierbei müssen die Interessen des Arbeitnehmers (etwa soziale Aspekte) am Erhalt des Arbeitsplatzes und die Interessen des Arbeitgebers, in einem kleinen Unternehmen möglichst wirtschaftlich arbeitendes und teamfähiges Personal zu beschäftigen, gegeneinander abgewogen werden. Denn in einem kleinen Unternehmen fällt jeder Mitarbeiter – ob qualifiziert oder unqualifiziert, gut oder schlecht fürs Betriebsklima – mehr ins Gewicht, als in einem großen Unternehmen, wo Defizite jeglicher Art in der Regel besser ausgeglichen werden können.
Problematisch für den Arbeitnehmer: ihn trifft die Beweislast für alle Umstände, weshalb die Kündigung nach „Treu und Glauben” unwirksam sein soll.
Vorgehen gegen eine Kündigung
Möchte der Arbeitnehmer gegen eine ausgesprochene Kündigung vorgehen, sollte er keine Zeit vergeuden: die Frist für eine Klageerhebung (Kündigungsschutzklage) beträgt drei Wochen ab Zugang der Kündigungserklärung. Hiernach gilt die ausgesprochene Kündigung ungeachtet jeglicher Umstände als wirksam.
Soweit der Grundsatz. Was aber in Fällen, die anders gelagert sind? Was, wenn die betreffende Arbeitnehmerin schwanger ist, es sich um einen schwerbehinderten oder einen ständig arbeitsunfähig erkrankten Arbeitnehmer handelt? Welche Besonderheiten gelten hier?
Besondere Umstände
1. Schwangerschaft, Mutterschutz und Elternzeit
Im Falle einer Schwangerschaft greift ein besonderer Kündigungsschutz. Dieser soll verhindern, dass der schwangeren Arbeitnehmerin aufgrund ihrer Schwangerschaft gekündigt wird.
§ 17 Mutterschutzgesetz besagt:
Die Kündigung gegenüber einer Frau ist unzulässig
- während ihrer Schwangerschaft
- bis zum Ablauf von vier Monaten nach einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche und
- bis zum Ende ihrer Schutzfrist nach der Entbindung, mindestens jedoch bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung, wenn dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung die Schwangerschaft, die Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche oder die Entbindung bekannt ist oder wenn sie ihm innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird.

Im Kern bedeutet dies, dass eine schwangere Arbeitnehmerin ab dem Zeitpunkt des Schwangerschaftsbeginns bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Geburt (oder Fehlgeburt nach der 12. Schwangerschaftswoche) nicht kündbar ist. Der Grundsatz des §17 MuSchG, dass schwangeren Arbeitnehmerinnen nicht gekündigt werden darf, gilt auch während der Probezeit.
Selbstverständlich greift dieser Kündigungsschutz unabhängig davon, ob sich die Arbeitnehmerin in einem Beschäftigungsverbot befindet, oder nicht.
Möchte der Arbeitgeber einer unter dem Schutz des Mutterschutzgesetzes stehenden Arbeitnehmerin kündigen, bedarf es einer Zustimmung der für den Arbeitsschutz zuständigen obersten Landesbehörde. Dies kommt nur in seltenen Ausnahmefällen in Betracht, etwa wenn bei Weiterbeschäftigung der Arbeitnehmerin die Existenz des Betriebs erheblich gefährdet wäre.
Der besondere Kündigungsschutz endet laut oben zitierter Norm in der Regel vier Monate nach der Entbindung. Befindet sich die Arbeitnehmerin über diesen Zeitraum hinaus in einem Beschäftigungsverbot (stillbedingtes Beschäftigungsverbot), ist sie unter etwaiger Berücksichtigung des KSchG ordentlich kündbar.
Eine in Elternzeit befindliche Arbeitnehmerin hingegen unterliegt weiterhin für die gesamte Dauer der Elternzeit dem besonderen Kündigungsschutz. Dies gilt selbstverständlich genauso für in Elternzeit befindliche Arbeitnehmer.
2. Schwerbehinderung
Ein weiterer Fall, in dem ein besonderer Kündigungsschutz greift, ist der des schwerbehinderten Arbeitnehmers. Dieser soll anderen Arbeitgebern gegenüber nicht aufgrund seiner Schwerbehinderung benachteiligt werden.
Nach den einschlägigen Normen sind Menschen i.d.R. schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt.
Möchte der Arbeitgeber ein Arbeitsverhältnis mit einem Schwerbehinderten kündigen, benötigt er hierzu die vorherige Zustimmung des Integrationsamtes – eine nachträgliche Zustimmung kann nicht erteilt werden, die Kündigung ist dann unwirksam.
Zu beachten gilt, dass zum Zeitpunkt der Kündigung die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nachgewiesen sein muss. Ein entsprechender Nachweis liegt dann vor, wenn das Versorgungsamt oder die nach Landesrecht zuständige Behörde einen Grad der Behinderung von mindestens 50 festgestellt hat.
Der besondere Kündigungsschutz greift nicht, sofern das Arbeitsverhältnis mittels Aufhebungsvertrag (Einigung der Parteien auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses) beendet werden soll, wenn ein befristeter Vertrag ausläuft, oder, wenn die Kündigung von Seiten des Arbeitnehmers ausgesprochen wird.
Auch entfaltet der besondere Kündigungsschutz keine Wirkung während der Probezeit.
3. Krankheit
Wird den oben genannten beiden Arbeitnehmergruppen noch ein besonderer Kündigungsschutz zuteil, so kann hingegen bei Arbeitnehmern, die häufig arbeitsunfähig erkranken, eine Kündigung gerechtfertigt sein.
Sicherlich trifft auch auf diese Gruppe der Kündigungsschutz des KSchG ab einer gewissen Betriebsgröße grundsätzlich zu, unter gewissen Umständen kann der Arbeitgeber einen immerzu kranken Arbeitnehmer aber dennoch entlassen.
Grundvoraussetzung hierfür ist, dass die krankheitsbedingten Ausfälle des Arbeitnehmers den Arbeitgeber bzw. den Betrieb unzumutbar belasten. Diese Belastung kann darin bestehen, dass der Arbeitgeber aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen auch während der
Ausfallzeiten des Arbeitnehmers dessen Gehalt fortzahlen muss, im Gegenzug hierzu aber aufgrund der Arbeitsunfähigkeit keine Arbeitsleistung erhält.
Eine wirksame krankheitsbedingte Kündigung setzt insbesondere voraus, dass zum Zeitpunkt der Kündigung damit zu rechnen ist, dass der Arbeitnehmer auch in Zukunft krankheitsbedingt seine arbeitsvertraglichen Pflichten nicht bzw. nicht in ausreichendem Umfang erfüllen wird und es deshalb bereits in der Vergangenheit zu erheblichen Beeinträchtigungen im Betrieb — Betriebsablaufstörungen oder wirtschaftliche Belastungen des Arbeitgebers — gekommen ist.
Schließlich hat der Arbeitgeber eine gegenseitige Interessensabwägung durchzuführen. Hierbei hat er u.a. zu berücksichtigen, wie lange das Arbeitsverhältnis ungestört Bestand hatte, ob der Arbeitnehmer eine Familie zu versorgen hat, ob er (aufgrund seines Alters) auf dem Arbeitsmarkt noch gut vermittelbar ist, oder ob er die Ausfallzeiten etwa durch Einstellung einer Ersatzkraft überbrücken kann. Hierbei sind also vielfältige Kriterien zu berücksichtigen, die letztendlich zu einer angemessenen Entscheidung zu führen haben.
Fazit:
Die Frage nach der Kündbarkeit eines Arbeitsverhältnisses ist von Fall zu Fall individuell zu beantworten. Im Einzelfall sind stets Umstände möglich, die eine Kündigung erheblich erschweren oder sogar gänzlich ausschließen.
Dies gilt allerdings grundsätzlich nur für Arbeitgeber – Arbeitnehmer sind in der Entscheidung, ob sie ein Arbeitsverhältnis fortführen möchten oder nicht, weitgehend frei.
Zugang zu allen Inhalten?
Jetzt Mitglied werden und sofort Zugang zu internen News, Infoartikeln, Mitglieder-Forum, Partnerprogrammen und vielen weiteren Mitglieder-Vorteilen erhalten.
Sie sind bereits Mitglied? Dann einfach hier einloggen.